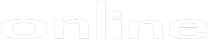Mathias Luderer und Karl Mann, Mannheim
Alkoholkrankheit
als psychiatrische Erkrankung
Deutschland liegt mit einem jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von 9,6 Liter reinem Alkohol weit vorne. Damit einher geht eine erhöhte Rate alkoholassoziierter Erkrankungen und Mortalität, aber auch von Alkoholmissbrauch und -abhängigkeit.
Definition
Missbrauch bzw. schädlicher Gebrauch besteht, wenn der Alkoholkonsum die körperliche oder psychische Gesundheit eindeutig beeinträchtigt. Riskanter Konsum liegt vor, wenn durch das Ausmaß des Alkoholkonsums die Wahrscheinlichkeit für Folgeerkrankungen deutlich erhöht wird. Einen Richtwert gibt die Empfehlung der WHO zum risikoarmen Konsum: die Grenze liegt bei Männern bei 20g reinem Alkohol pro Tag (ca. 0,5l Bier), bei Frauen deutlich darunter (12g pro Tag = 0,33l Bier).
Die Abhängigkeit wird nach ICD-10 über sechs Kriterien definiert (Tab. 1), von denen mindestens drei im Laufe eines Jahres erfüllt sein müssen. Somit kann auch ohne Vorliegen von Entzugssymptomen oder körperlicher Schädigung eine Abhängigkeit bestehen.
Epidemiologie
In Deutschland gibt es 2 Mio. Menschen mit einer Alkoholabhängigkeit, von denen nur 10% den We in eine sucht-medizinische Behandlung finden. Für rund 4 Mio. besteht ein Behandlungs- und für weitere 4-6 Millionen ein Beratungsbedarf. In internistischen und chirurgischen Abteilungen sind in der Regel über 20% der Patienten alkoholabhängig. Hausärzte sehen etwa 80% der Alkoholabhängigen mindestens einmal im Jahr.
Bei Behandelten besteht ein hohes Rückfallrisiko. Erschwerend kommt eine Vielzahl psychiatrischer Komorbiditäten hinzu (Tab. 2).
Umgekehrt zeigten z.B. Patienten mit affektiven Erkrankungen eine hohe Prävalenzrate von 20-40% für alkoholbedingte Störungen. Die hohe Prävalenz psychiatrischer Erkrankungen spiegelt sich auch in der Suizidrate wider: Knapp ¼ aller Alkoholabhängigen unternimmt Suizidversuche; 5-10% sterben durch Suizid.
Neurobiologie
Familiäre Einflussfaktoren spielen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Alkoholabhängigkeit, wobei genetische Faktoren ca. 40-60% der Prädisposition ausmachen. So führen bestimmte Varianten der Aldehyddehydrogenase und des CYP2E1 zu einem beschleunigten Abbau von Alkohol, dadurch wird die Empfindlichkeit für die Nebenwirkungen des Alkoholkonsums reduziert. Menschen, die Alkohol gut vertragen, trinken wiederum häufiger und mehr, sodass das Risiko für eine Alkoholabhängigkeit erhöht ist.
Alkohol führt bei häufiger und hoher Einnahme zu einer Blockade exzitatorischer NMDA-Rezeptoren, aus der Gegenregulation resultiert eine Zunahme der Rezeptordichte und –aktivität. Außerdem führt chronischer Alkoholkonsum zu einer verminderten Ansprechbarkeit von GABAA-Rezeptoren. Beim Alkoholentzug kommt es daher zu einer Dysbalance zwischen exzitatorischer und inhibitorischer Wirkung, wodurch Entzugskrampfanfälle entstehen können. Das mesolimbische dopaminerge Belohnungssystem spielt eine wichtige Rolle bei Rückfällen. Eine Dopamin-vermittelte Stimulation des Nucleus accumbens führt zu einer erhöhten Aufmerksamkeit für belohnungsassoziierte Stimuli und zu Suchtverlangen. Dabei wird Dopamin bei wiederholter Konfrontation vermehrt freigesetzt, sodass es zu einer Verstärkung des Verhaltens kommt („Suchtgedächtnis“). An dieser Stelle setzt auch Nalmefen an, ein gerade neu zugelassenes Medikament zur Reduktion des Konsums bei Alkoholabhängigen.
Eine Dopamin-Blockade durch Antipsychotika führt eher zu einer erhöhten Rückfallquote, hingegen könnte die Blockade der striatalen µ-Opioid-Rezeptoren zu einer indirekten Dopaminfreisetzung im Striatum und somit zu einer verminderten Rückfallrate führen.
Behandlung
Alkohol hat ein geringeres Abhängigkeitspotential als Heroin oder Nikotin. Die Abhängigkeit entwickelt sich über Jahre bis Jahrzehnte. Die meisten Betroffenen würden sich ein Leben ohne Abhängigkeit wünschen, vor allem der Zwang zum Trinken bei schweren Entzugssymptomen ist für viele eine Qual. Andererseits hilft die Substanz vielen, um zumindest initial Stress zu bewältigen. Mit der Zeit entwickelt sich der Alkohol zur einzigen Bewältigungsstrategie und drängt gesündere Handlungsalternativen in den Hintergrund. Alkohol wird zum wichtigsten Lebensinhalt.
Früherkennung
Alkoholabhängigkeit ist stark stigmatisiert und die Betroffenen haben oft große Hemmungen, sich und anderen das Ausmaß ihres Konsums einzugestehen.
Zur Früherkennung können sich indirekt die typischen Laborparameter (GGT, Transaminasen, MCV, als Langzeitparameter CDT) vor allem in Kombination eignen. Direkte Alkoholabbauprodukte (wie z.B. Ethylglucuronid in Haaren, im Urin) sind hochsensitiv und spezifisch und werden vor allem bei forensischen Fragestellungen oder bei der Beurteilung der Therapietreue, weniger zur initialen Diagnostik eingesetzt.
Bei diesem Vorgehen muss beachtet werden, die Patienten nicht in der Art eines Indizienprozesses überführen zu wollen. Das offene und empathische Gespräch wird durch die genannten Parameter nicht ersetzt; die auffälligen Werte können aber zum Anlass für ein solches Gespräch genommen werden bzw. als Motivation genutzt werden.
Oft fühlen sich die Betroffenen dann erleichtert durch das
Gesprächsangebot und berichten offener über ihre
Probleme.
Standardisierte Fragebögen wie z.B. der AUDIT (in der Kurzversion AUDIT-C mit nur 3 Fragen können eine Hilfe bei der Früherkennung sein und bei auffälligen Angaben auch Anlass zu einem Gespräch bzgl. des Konsums bieten.
Frühintervention
Die Ambivalenz zwischen den kurzfristig positiven und langfristig negativen Konsequenzen des Konsums ist bei Abhängigen besonders ausgeprägt, sodass die Bereitschaft zur Veränderung stark schwanken kann, aber durch gezielte Interventionen auch positiv beeinflusst werden kann.
Insbesondere in der Gruppe der riskant Konsumierenden
zeigen sich kurze Interventionen als wirksam, während bei
bestehender Abhängigkeit verstärkt das Suchthilfenetz (Beratungsstellen,
Selbsthilfegruppen) einbezogen werden muss.
Kurzinterventionen von ca. 10-20 Minuten, die häufig Elemente der motivierenden Gesprächsführung enthalten, zeigen gute Effekte bzgl. der Abstinenzmotivation. Die Patienten sollen dabei nicht durch Konfrontation in eine Abwehr gezwungen werden, sondern durch offene, wertfreie Fragen zur Reflexion veranlasst werden. Wesentliche Merkmale sind eine empathische Grundhaltung, die Förderung der Veränderungsbereitschaft, der Aufbau von Vertrauen in die Selbstwirksamkeit und die Vereinbarung gemeinsam festgelegter Ziele. Für den Alltag bietet sich das „Behavior Change Counseling“ (BCC) als leichtere und weniger aufwendige Abwandlung an. Gute Tipps für den Alltag zum Umgang mit Alkoholabhängigen und eine Sammlung der typischen Fehler in der Gesprächsführung finden sich in den Broschüren der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen.
Suchtmedizinische Behandlung
Begeben sich Alkoholabhängige nach Motivation durch Hausärzte, Beratungsstellen oder das Umfeld in Behandlung, steht zu Beginn häufig der körperliche Entzug im Vordergrund. Eine reine Entgiftung hat dabei aber so gut wie keinen längerfristigen Effekt.
Die „qualifizierte Entzugsbehandlung“ beinhaltet eine mehrwöchige (teil-)stationäre Behandlung, wobei die Motivationssteigerung ein wichtiges Behandlungselement ist. Hier soll der Patient während der sensiblen Phase der Entgiftung dazu motiviert werden, abstinent zu leben und das Suchthilfenetzwerk in Anspruch zu nehmen. Hierdurch erhöht sich die Effektivität der qualifizierten Entzugsbehandlung deutlich gegenüber der reinen körperlichen Entgiftung.
Alkoholentzug
Die medikamentöse Behandlung des Alkoholentzugs soll die Dysbalance zwischen der Überstimulation glutamaterger Neurone und der verminderten GABAA Neurotransmission ausgleichen und Entzugs-Grand-Mal-Anfälle sowie Delirien verhindern.
Im stationären Rahmen werden zumeist Clomethiazol oder Benzodiazepine (z.B. Diazepam) eingesetzt. Die Verabreichung sollte möglichst symptomorientiert erfolgen (z.B. durch geschulte Pflegekräfte anhand des CIWA-Fragebogens).
Im ambulanten Rahmen sollte eine medikamentöse Unterstützung nur bei bekannten und absprachefähigen Patienten stattfinden. Der Patient sollte sozial stabil sein und es sollten keine schwerwiegenden psychiatrischen Begleiterkrankungen vorliegen. Ein Krampfanfall oder Delir in der Anamnese sowie schwerwiegende internistische Erkrankungen schließen eine ambulante Entgiftung aus. Der Patient sollte explizit darauf hingewiesen werden, dass eine Kombination von Alkohol mit Beruhigungsmitteln eine lebensbedrohliche Mischintoxikation zur Folge haben kann.
Ein lebensbedrohliches Entzugsdelir (Delirium tremens)
entwickelt sich bei ca. 5% der Alkoholabhängigen, die unter vegetativen
Entzugssymptomen leiden und keine medikamentöse Behandlung erhalten. Das
Hauptsymptom ist dabei die Desorientierung. Daneben können visuelle, taktile
und akustische Halluzinationen auftreten, manchmal Grands-
Mal-Anfälle sowie Bewusstseins- und kognitive Störungen. Typischerweise kommt
es zusätzlich zu psychomotorischer Unruhe („Nesteln“). Differentialdiagnosen
müssen durch Labordiagnostik und zerebrale Bildgebung ausgeschlossen werden.
Nach Diagnosesicherung wird das Delirium tremens vorzugsweise durch i.v.
Benzodiazepine behandelt, normalerweise in Kombina-
tion mit der Gabe von hoch-potenten Antipsychotika (z.B. Haloperidol). Bei
Intensiv-Patienten nach einem Trauma erfolgt die symptomorientierte Behandlung.
Außerdem erfolgt der Ausgleich von Flüssigkeits- und Elektrolytdefiziten. Unter dieser Therapie klingt das Delirium meist in 2-4 Tagen ab. Aufgrund klinischer Erfahrung wird zur Prophylaxe einer Wernicke Enzephalopathie ergänzend die Gabe von Thiamin (50 mg langsam i.v. oder i. m.) empfohlen.
Suchtmedizinische Behandlung und Prognose
Die meist 4 bis 6 Monate dauernde stationäre Entwöhnungsbehandlung („Langzeittherapie“) in Suchtfachkliniken, die von den Rentenversicherungsträgern finanziert wird, ist ein wichtiges Element im Gesamtbehandlungsplan. Sie soll sich vor allem an Patienten richten, bei denen schwerwiegende körperliche, psychische oder soziale Probleme vorliegen, deren soziales Umfeld keine ausreichende Unterstützung bietet, die beruflich nicht integriert sind, bei denen keine stabile Wohnsituation gegeben ist oder wiederholte Rückfälle während der ambulanten oder teilstationären Postakutbehandlung aufgetreten sind.
Ergänzend zu der stationären Entwöhnungsbehandlung bieten psychosoziale Beratungsstellen (Suchtberatungsstellen), Psychiater und Psychotherapeuten seit einigen Jahren ambulante Entwöhnungsbehandlungen an. Diese richten sich vor allem an Patienten, bei denen eine gute soziale Integration (Familie, Arbeit) und die Fähigkeit, zu Beginn der Entwöhnungsbehandlung eine alkoholabstinente Phase zu erreichen und zu halten, vorhanden ist. Die Behandlung kann sowohl als Gruppen- als auch als Einzeltherapie durchgeführt werden; die Behandlungsfrequenz beträgt 1-2 Sitzungen pro Woche, die Gesamtbehandlungsdauer liegt bei ca. einem Jahr.
Eine multizentrische prospektive Studie in 21 stationären Behandlungseinrichtungen in Deutschland konnte zeigen, dass von 1410 Patienten nach 18 Monaten 53% und nach 4 Jahren 46% der alkoholabhängigen Patienten nach einer spezifischen Therapie abstinent blieben. Dem gegenüber wurden 80-85% aller Patienten ohne spezifische Therapie innerhalb eines Jahres wieder rückfällig. Andere Untersuchungen zeigten Abstinenzraten nach einer mehrmonatigen Rehabilitationsbehandlung bis 70% nach 1 Jahr und bis zu 50% nach 16 Jahren erreicht.
Eine ambulante Psychotherapie kommt vor allem bei Patienten mit psychiatrischer Komorbidität in Frage, dabei bestehen jedoch Wartezeiten von oft mehreren Monaten. Auch schließen viele Psychotherapeuten die Behandlung von Patienten mit Suchterkrankungen von vorne herein aus.
Medikamentöse Rückfallprophylaxe
Eine medikamentöse Rückfallprophylaxe sollte immer im Rahmen eines sucht-medizinischen Gesamtkonzepts (z.B. bei qualifizierter Entzugsbehandlung oder bei gleichzeitiger Teilnahme an Selbsthilfegruppen) begonnen werden.
Der Opioid-Antagonist Naltrexon (Adepend®) und der Glutamatmodulator Acamprosat (Campral®) sind in Deutschland zur Rückfallprophylaxe zugelassen und wirksam. Ihre Anwendung empfiehlt sich nur bei entgifteten Patienten. Vor kurzem wurde der Opioidmodulator Nalmefen (Selincro®) zugelassen. Er kann in einem neuen „harm reduction“-Ansatz die Trinkmenge bei Alkoholabhängigen reduzieren. Ob damit die alkoholbezogene Mortalität und das generelle Funktionsniveau verbessert werden können, muss weiter geprüft werden. Substanzen mit Wirkung auf das cholinerge, dopaminerge und serotonerge System konnten bisher keine abstinenzverlängernden Effekte zeigen.
Das Aversiv-Medikament Disulfiram bewirkt bei regelmäßiger
Einnahme und gleichzeitigem Alkoholkonsum Vergiftungserscheinungen, die in
Einzelfällen tödlich enden können. Darüber hinaus ist die Behandlung nur bei
mehrfach wöchentlicher supervidierter Vergabe durch geschultes medizinisches
Personal oder Familienangehörige wirksam.
Daher bleibt diese Art der Behandlung einer besonderen Patientengruppe
vorbehalten und sollte nur von spezialisierten Kollegen vorgenommen werden.
Weiterhin wird die Anwendung dadurch erschwert, dass nach der Rückgabe der
Zulassung durch den Hersteller für Deutschland das Medikament nun über
internationale Apotheken bezogen werden muss und die Krankenkassen nicht mehr
zur Kostenübernahme verpflichtet sind.
Immer wieder äußern Patienten den Wunsch nach einer Medikation mit dem Muskelrelaxans Baclofen, nachdem sie von der erfolgreichen Selbstbehandlung des Arztes Ameisen gehört haben. Die Dosierung lag dabei weit über dem für Deutschland zugelassenen Bereich für ambulante Behandlungen. Es gibt Hinweise auf die Wirksamkeit einer niedrig dosierten Baclofen-Therapie bei Patienten mit Leberzirrhose, in anderen Bereichen widersprechen sich die Untersuchungsbefunde. Längerfristige Studien zur Dosierung, Sicherheit und Wirksamkeit sowie ggf. dem Abhängigkeitspotential von Baclofen stehen noch aus. Eine off-label Verschreibung ist möglich, sollte jedoch nur mit größter Vorsicht vorgenommen werden.
Das Therapieziel der Abstinenz kann bei schwerer Abhängigkeit zugunsten eher erreichbarer Ziele (Sicherung des Überlebens, Verhinderung von Folgeschäden) verlassen werden. Die Reduktion der Trinkmenge zur Senkung des Risikos für Folgeerkrankungen („harm reduction“) als mögliches Therapieziel für Patienten, die nicht-abstinenzwillig oder –fähig sind, wird seit ein paar Jahren diskutiert. Die neuen Befunde mit Nalmefen (Selincro ®) sind vielversprechend, insbesondere auch mit Blick auf eine erniedrigte Eignungsschwelle. Letztlich müssen aber die weiteren Erfahrungen zu einer endgültigen Bewertung abgewartet werden.
Literatur beim Verfasser